Der (vor)letzte Prolet - über das neue Ernst Busch-Buch
 von Tanja Krienen
„DU HAST DAS WORT, REDE, GENOSSE MAUSER“. „WIE HEISST DAS?“ „LINKER MARSCH“
So wie oben wird im neuen Busch-Buch geredet. Zeitgeist mit einfacher Sprache? Nein, kein Zeitgeist, eher das Gegenteil davon. Einfache Sprache? Ein wenig. Und warum? Darum! Weil es halt ein Comic ist, oder neudeutsch eine „Graphic Novel“, will sagen: bebilderte Literatur bzw. ein Comic für Erwachsene. Jener in der Titelzeile zitierte Dialog, ist einer zwischen Ernst Busch und Ulrike Meinhof. Ja genau die! Wurde sie also von ihm inspiriert? Das wäre zu schlicht gedacht. Und doch hat sie ihn mehrfach in seinem Haus in Pankow besucht, ihn, der ihr die „Ballade von der Hanna Cash“ in einer privaten Einspielung auf ein Tonband eingesungen hatte. Sie traf ihn Jahre zuvor zum ersten Mal mit ihrem Mann, dem Konkret-Herausgeber Klaus Rainer Röhl, der vor Busch auf den Knien rutschend comicalartig portraitiert wird, in der Garderobe des Berliner Ensembles. Ist das alles genau so geschehen? Die Grundfakten sicher und ebenso sicher sind manche Dialoge als Fiktion zu betrachten, einiges als Phantasie, so, wie der bei Buschs Beerdigung in den Bäumen sitzende Wolf Biermann („Er >Busch ist gemeint, Anm. TK< entgeht meiner Liebe nicht!“), der übrigens gleich zweimal auftaucht, zuvor nämlich in Buschs Abschiedsvorstellung des Galileo Galilei 1961, wo er schräg hinter Erich Honecker, Markus Wolf und anderen mit Eva Hagen im Publikum platziert ward.
Worum dreht es sich eigentlich im neuen Buch über Ernst Busch? Wie wir ja wissen, ist das Einfache oft schwierig zu machen, weil das aber selbst mit dem Kommunismus nicht so leicht war, braucht auch ein Comic Tricks. Für was? Na, um das Leben von Busch zu erzählen. Und das geht so: Der Maler Ronald Paris soll um das Jahr 1970 Busch portraitieren. In einer Ausstellung erblickt das Bild dann das Licht der Welt, besser: das grelle Licht der schrillen Welt erblickt ES und ruft sogleich alle auf den Plan: eine protestierende Teil-Öffentlichkeit, die schockierte Partei und nicht zuletzt Busch selbst. Tatsächlich ist das Bild missraten, von der Form und Inhalt gleichermaßen. Es will den Held vom Sockel holen, tötet ihn aber dabei, meint: es zeigt einen extrem angeschlagenen, in seinem Feierabendstuhl mehr hängenden als sitzenden, schwer gebrechlichen alten Mann, der selbst mit seinen Händen nicht so recht weiß wohin und dessen entgleisende Gesichtszüge die eines Trinkers aufweisen. Vom Auge, aus einer tiefen Verschüttung wirr blickend, ganz zu schweigen. Dabei wusste doch jeder um das schwere Schicksal des Sängers, der sich seine taube Gesichtshälfte als Häftling der Nazis durch alliiertes Bombardement - quasi unter friendly Fire - einfing. Der Staat kauft das Bild wohl auf – es bleibt bis heute verschwunden. War da verkehrt oder „stalinistisch“? Wer darüber richten will, schmeiße die erste Bombe. Jedenfalls; um diese Grundgeschichte herum wird Buschs Leben erzählt, immer schwarz-weiß, während diese misslungene Portrait-Angelegenheit in farbigen Bildern erstellt ist. Das ist keine böse Absicht, sondern nur ein Kniff. Die einzelnen Lebensepisoden werden dann chronologisch von Freunde und Weggefährten Buschs erzählt so zum Beispiel von Eva Busch, Hanns Eisler, Gustav Gründgens, Pete Seeger, Ulrike Meinhof u.a..
Buschs Haltung wird sichtbar als die eines kluges, kämpferischen Arbeiters, der nicht über Identität reden musste, sondern verkörperte: lapidarer Umgangston, forsch, direkt, schroff, ohne Sentiments, weil nun einmal ganz norddeutsch (und westfälisch) gesagt werden muss, was gesagt werden muss. Und diese Haltung ruft beim Lesen manchmal lautes Lachen hervor, wenn man den Busch dabei in allerlei Situationen bebildert sieht – und ihm in seiner Haltung im Geiste beipflichtet. Diese Hände-In-Den-Taschen-Mentalität, dieses „Ach-Leckt-Mich-Doch-ALLE-Kreuzweise“. ´türlich kann das auch ätzend sein, anstrengend, wer will schon einen ewigen humorlosen Grantler um sich? Oder einen extrem verbissen arbeitenden Kollegen? War er das wirklich? Hat sein Verhalten zur Folge, dass man sich gut mit ihm stellen will, um nichts abzubekommen? Bleibt man ihm irgendwann fern, weil es nicht zu ertragen ist? Er selbst jedenfalls machte keinen Unterschied zwischen den Adressaten, „konnte selber nicht freundlich sein“, aber wem sag ich es? Selbst wenn er eine Prise Kinski täglich zu sich genommen hätte: Er muss aber doch wohl auch empathisch gewesen sein, wie sonst hätte Gründgens ihn, er aber auch Gründgens retten, resp. helfen können/wollen?
Das Buch trägt den Titel „Der letzte Prolet“. Ob es passt? Schließlich war Busch vor allem Künstler und…ja, auch sechs Jahre „Prolet“, vor allem hinsichtlich des familiären Backgrounds (Vater war Maurer). Fragen einer lesenden Arbeiterin: Ist der Begriff “Prolet†eher eine psychologisch, soziologische oder eine ökonomische Kategorie? Müssen wir den “Prolet†nicht vom “Lumpenproletarierâ€, resp. ungelernten Arbeiter bzw. Arbeiterin trennen? Der “klassenbewusste Prolet†zeichnete sich früher auch durch den Erwerb von Bildung über das erworbene Schulwissen aus. Wo und wie ist das heute möglich? Auch ich bin oft sehr direkt, gehe selten einem Streit aus dem Weg, kann ziemlich “böse†werden, “pöbele†auch gelegentlich zurück und habe vor allem einen Maurer als Vater! Darf ich mich wohl allerletzte Proletin nennen und gibt es nicht immer noch andere, neue? Fragen über Fragen. Die sie stellen, verdienen Antwort. Jochen Voit, der Autor, meinte dazu: „Dass die Antwort auf Deine Frage zum Titel nur eine ganzheitliche sein kann, die das Schillernde und Schimpfliche, das Soziologische und Ideologische mitdenkt, wird sich Dir beim Betrachten und Lesen hoffentlich erschließen…“ Na klar. War ja auch nur rhetorisch….
Jochen Voit, bekannt schon u.a. durch seine Busch-Biographie „Er rührte an den Schlaf der Welt“, legt hier ein stimmiges Portrait vor, kongenial illustriert durch Sophia Hirsch. Im Avant-Verlag auf großdimensionierten 250 Seiten erschienen, kostet es angemessene 26 Euro – und ist diese auch wert! Das Buch liest sich flott, aber es kann auf Grund der zwangsläufig etwas springenden Handlung bestimmt nicht schaden, wenn man sich in der Historie und mit Buschs Leben auskennt.
Zuletzt: Kurioserweise wurde das Buch von der „Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ gefördert. Das macht nix und tut nicht weh. Niemandem. Auch weil: Mythen darin erzählt, belebt, eingerissen und wieder errichtet werden. Gut so, schließlich brauchen „wir“ doch alle unsere Bezüge, unsere Dreiviertelwahrheiten, Anekdoten und objektiv-subjektive Fakten. Und wie freue ich mich schon auf die gewiss kommende Zeit, da eine „Rätestiftung zur Aufarbeitung der Corona-Diktatur“ 30 Jahre und mehr Geschichten erzählen darf.*
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Ernst Busch-Gesellschaft  1/2022
*Der letzte Satz wurde nicht gedruckt.

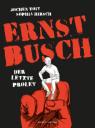
https://www.unsere-zeit.de/persoenlich-hat-er-manchmal-anarchistische-tendenzen%E2%80%89-54759/
Kommentar von Campo-News — 26. Januar 2022 @ 10:53
Modrow konstatiert in dem Brief, Die Linke sei sich nicht mehr im Klaren darüber, »was ihr Zweck ist«. Er fragt, warum die Wähler einer Partei ihre Stimme geben sollten, »deren vordringlichstes Interesse darin besteht, mit SPD und Grünen eine Regierung« zu bilden. Dass diese Vorstellung unter Mandatsträgern dominiere, sieht Modrow als Resultat eines jahrzehntelangen Prozesses. https://www.nd-aktuell.de/artikel/1160765.konflikte-in-der-linkspartei-modrow-warnt-seine-partei-vor-irrwegen.html
Kommentar von Campo-News — 26. Januar 2022 @ 11:00
https://www.unsere-zeit.de/persoenlich-hat-er-manchmal-anarchistische-tendenzen%E2%80%89-54759/
Kommentar von Campo-News — 2. Februar 2022 @ 18:12
..und nun auch in den “Eisler Mitteilungen” der “Hanns Eisler Gesellschaft”
Kommentar von Campo-News — 27. Februar 2022 @ 19:43
Bei der UZ - Ja, das gilt für alle linken Parteien, die ihre Linksliberalität so aufplusterten, dass daraus ein Gutmenschentum entstand, welches sich nicht vom elitären Gehabe calvinistischer Propagandisten unterscheidet und so in Philosophie und Kultur von den Prinzipien der Arbeiterklasse entfremdete oder sogar eine feindliche Haltung einnimmt. Ich befürchte, dass unzählige junge Scheinlinke überhaupt nicht wissen um was es geht, weil ihnen der Zugang nie offensiv nahegebracht wurde. Debatte im 68er Stil, klar, lauter, polemisch usw.. sind ihnen völlig wesensfremd.
Kommentar von Campo-News — 23. Mai 2022 @ 15:53
https://youtu.be/JxeQvHr5OBM
Kommentar von Campo-News — 27. Mai 2022 @ 10:00
https://youtu.be/r-iBm_jjSqU
Kommentar von Campo-News — 27. Mai 2022 @ 10:03
„Persönlich hat er manchmal anarchistische Tendenzen“?*
UZCategoriesKultur | UZ vom 12. Oktober 2018
Von Tanja Krienen
*?Walter Ulbricht
Ernst Busch als Darsteller in der Inszenierung der „Mutter Courage“ des Berliner Ensembles 1946
Ernst Busch als Darsteller in der Inszenierung der „Mutter Courage“ des Berliner Ensembles 1946
( Abraham Pisarek/Deutsche Fotothek/Wikimedia Commons / Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE)
Wer war eigentlich dieser Ernst Busch? Als der 1900 in Kiel geborene Sänger und Schauspieler Ernst Busch im Juni 1980 in Berlin (DDR) starb, war sein Name weitgehend im öffentlichen Leben „seines Landes“ nicht mehr präsent, wurde sein Werk nur von relativ wenigen Interessierten gewürdigt und in Ehren gehalten. „Staatskünstler“ war er ohnehin nie und das Volk tendierte sowieso zur leichten Muse. So ist es – mit ein paar kleineren Varianten – bis heute geblieben. Das sollte nachdenklich stimmen und an den Namen Ernst Busch wieder häufiger erinnern.
Nicht, dass man ihn nicht in der DDR kannte. Seine Lieder jedoch wurden früh historisiert, waren mit den fernen und beendeten Kämpfen in Spanien oder gegen die Rechtstendenzen in der Weimar Republik verbunden, maximal noch mit der sich formierenden DDR, doch ihr Originäres und das zeitlos Exemplarische wurden von je her unterschätzt oder aus kalkulierten politischen Gründen ignoriert. Mal wurde ihm „Proletkult“ vorgeworfen, mal „Formalismus“, dabei war er nur immer ein Künstler, der sich an den Stoffen seiner Zeit orientierte und dies hart, klar, plakativ, aber auch auf seine Weise emotional umsetzte. Wenn Lieder wenig mit ihm zu tun hatten, so merkte man es seinen Interpretationen auch an, besonders authentisch war er, wenn sich sein eigener Erlebnis-Horizont in Liedern spiegelte. Davon gab es überreichlich.
Warum also Busch? Weil seine Systematik, seine Herangehensweise, seine künstlerische Umsetzung so klug und so adäquat ist, dass ihre handwerkliche Einzigartigkeit vermittelt und ihr Charakter aufs Neue reflektiert und mit Leben gefüllt werden sollten. Er ist ein Maßstab und kreierte einen eigen Stil. Man muss ihm nicht in jedem Detail der politischen Agenda folgen, man darf ihn vielleicht sogar in seltenen Fälle des „Zauderns“ lächelnd beckmessern, man muss auch nicht die wenigen, allzu pathetischen, hymnenartigen Ausreißer als vorbildlich herausstellen und man sollte ihm freundlichst das Überzeichnen verzeihen, so, wie man auch jedem Dramatiker den zu stark akzentuierten Einfall nachsieht, wenn er doch ein insgesamt stimmiges Werk vorlegt.
Zu diesem Werk gehören in nicht geringem Umfang die Vertonungen literarischer Klassiker: Brecht, Tucholsky, Kästner, Mühsam, Wedekind, Becher, Fürnberg, aber auch Mehring, Klabund oder Robert Gilbert alias David Weber. Sie sind zeitlos gut, vorbildlich interpretiert, ohne falsche Romantik und Sentiments. Die Verschlimmbesserungen durch moderne Attitüden mancher „Chansonsänger“ zeigen das ganze Dilemma heutiger, effekthaschender Auffassungen. Busch liebte die einfache Struktur, nicht die Pirouette. In den seltenen Fällen, da er selbst die Musik zu bestehenden Texten schrieb, nutzt er das echte Volksliedhafte im besten Sinne. Mehr noch, er erschloss sogar alte Verse zum neuen Gebrauch, indem er die sperrigen musikalischen Kunstlied-Vorlagen verwarf und sie in eine gängige Melodie kleidete. Hannes Wader sagte einmal sinngemäß, er habe „Die Ballade von der Hanna Cash“ erst für sich adaptieren können, als er auf die Busch-Komposition des Liedes stieß. Ähnlich gelagert ist der Fall bei der „Legende von der Dirne Evelyn Roe“. Erst Busch machte daraus ein auch singbares Lied mit regionalen Anklängen.
Die aktuelle Kultur der deutschsprachigen Linken bietet oft keinen überzeugenden Anblick. Wer sich nicht dem Sound der neuen Staatskünstler Marke „Tote Hosen“ hingeben will, muss sich mit Allerweltsplattitüden, Betroffenheits- und Sozialkitschlyrik, direkt aus dem Liz-Mohn- Kosmos für die durch die Regenbogen Presse gestählten Hausfrau begnügen. Die Umsetzung aktueller Stoffe in angemessene Formate fehlt fast völlig. Es bleibt auf dem Gebiet der Musik meist beim fragwürdigen Gewummere oder des im Mainstream schwimmenden, gut kanalisierten Scheinprotestest mit gefühligem Massenpop, Metaphorischem und allegorischem Einerlei. Soll man die Jugend dort abholen? Wenn sie sich lässt, gern! In dem man ihren Stil kopiert? Wieso sollte man das?
Aber es geht: Die jungen Leute hätten Probleme mit Ernst Busch, sagte jemand zu mir am Stand des Pressefestes. Damit muss man nicht leben, entgegnete ich. Junge Menschen wollen durch Erklärungen und Emotionen gleichermaßen an eine andere, nicht am Mainstream orientierte Kultur herangeführt werden. Auch in solch finsteren Zeiten, in denen die eigene Sprache zum exotischen Raum wird. Nachdem wir mit ihm ins Gespräch kamen („Bullshit“ sei die Meinung der Alten über die Musik der Jungen), kaufte dann doch ein 24jähriger zwei Ernst- Busch-CDs.
Ein anderer Mann zeigte sich besonders erfreut über die Tatsache, dass man „alles geschliffen hat, nur nicht den Namen der Schauspielschule“. Das zeigt, warf ich ein, dass man sich nicht traute: „Er war wohl zu groß.“ Wir freuten uns gemeinsam und sehr diebisch. Dass man die größte deutsche Schauspielschule weiterhin nach Ernst Busch benennt (ja bitte: nach wem auch sonst?), ist löblich, aber folgenlos, wenn man sich nicht für seinen Spin, respektive sein Handwerk, das an Brechts Vorgaben orientiert ist, interessiert. Schon richtig, viele Brechtepigonen haben das Theater oder den Film nicht besser gemacht, weil Wollen und Können zweierlei sind und Kopfgeburten ohne Körper unzulänglich bleiben müssen. Heute aber gibt es diese Vorgaben, dieses Ziel überhaupt nicht mehr. Man kann zudem keinen echten Menschen aus dem Volk darstellen, wenn sein Wesen unbekannt ist, sondern nur als Muttis Liebling und von ihren Gnaden, sein Dasein als ein kopistischer Zwischenwirt fristen. Doch nur mit dem Wissen um dieses Handwerk und mit wahrhaftiger Umsetzung kommen wir ein paar Schritte weiter, lernen vielleicht, neu zu laufen, zu stürmen und zu siegen.
Kommentar von Campo-News — 2. Juni 2025 @ 04:49